Schenkelweichen gehört nicht zu den klassischen Seitengängen und genießt nicht immer einen guten Ruf.
Was mich immer sehr traurig macht ist die Konversation mit Schülern, die sich schämen oder unsicher sind, wenn sie manche Inhalte in ihre Trainingsprogramm aufnehmen.
Sie haben das Gefühl Schenkelweichen oder Leichttraben hilft ihnen und ihrem Pferd – aber WEIL eben immer wieder auch negativ über das Schenkelweichen geurteilt wird fühlen sie sich schlecht und werden noch unsicherer.
Schenkelweichen, oder: Das ist gut und das ist schlecht
Bei dieser Causa komme ich nicht umhin, mich zu fragen – wer entscheidet, was gut ist und was nicht? Wenn mir eine Schülerin die Ausbildung und die gewählten Schritte ihres Pferdes erklärt und sich für diese Schritte rechtfertigt, weil sie beispielsweise zum Lösen das Leichttraben oder das Schenkelweichen wählt, dann ist das nicht in Ordnung.
Wer entscheidet denn, was gut ist und was nicht? Logisch lassen sich einige Punkte mit allen Pros und Contras erklären – und JEDE Sache hat ihre Pros und Contras. Ein komplett falsch interpretiertes Schulterherein wird dem Pferd auch mehr schaden als nützen – da kann man das Schulterherein noch so oft als „Aspirin der Reitkunst“ bezeichnen.
Letztlich entscheidet immer das Pferd – und ein fachkundiger Trainer weiß, in welcher Schulstufe oder bei welchem Ausbildungsstand Inhalte auf den Stundenplan kommen können, wenn die Basis dafür stimmt.
Warum das Schenkelweichen oft schlecht weg kommt
Betrachten wir also diesmal die Geschichte vom Schenkelweichen – warum das manchmal nicht so gut weg kommt?
Schenkelweichen ist tatsächlich in der Akademischen Reitkunst nicht gerade Usus. Aber warum eigentlich nicht? In der FN oder klassischen Reitkunst wird Schenkelweichen als lösende Übung verstanden und auch für das Etablieren des Schenkelgehorsam verwendet.
Der kritische Punkt ist wie folgt:
Wenn wir unser Pferd biegen, dann haben wir aus Vogelperspektive betrachtet, ein gebogenes oder spiegelverkehrtes „C“ in der Wirbelsäule. Beim Schenkelweichen bleibt das Pferd relativ gerade und das jeweilige innere Hinterbein steigt vom Schwerpunkt stark weg, das heißt, das Pferd tritt nicht nach vorne sondern eher seitlich unter die Masse. Wenn das Pferd seinen Körper dann vom stehenden Hinterbein weg schiebt, dann entsteht je nachdem ob wir nach links (spiegelverkehrtes S) oder nach rechts gebogen sind ein S in der Wirbelsäule – immer aus Vogelperspektive.
Über das Contra habe ich vor einiger Zeit für mein Forum der Online Akademie ein kleines Video gemacht:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere InformationenDas heißt, die konstante Biegung geht verloren und ich bringe dem Pferd auch noch im schlimmsten Fall bei vom Schwerpunkt weg zu treten – dabei ist es ja unser Ziel immer um den inneren Schenkel zu biegen und nicht davon weg zu gehen. Ein sehr ähnliches Problem ist das übertriebene Übertreten.
Aber…..die Sache hat immer zwei Seiten
Aber wer sagt, dass das Pferd automatisch und unbedingt die Biegung verlieren muss?
Schlagen wir mal bei Alois Podhajsky nach. Er schreibt in seiner „Klassischen Reitkunst“:
„Zur Vorbereitung der Seitengänge dient das Schenkelweichen, finde das Pferd mit der Wirkung des seitwärts treibenden Schenkels vertraut gemacht wird. Dem Schenkelweichen solll aber niemals mehr Bedeutung beigemessen werden, als ihm zukommt. Es soll nur dem Begreiflichmachen der Hilfen dienen. Leider ist in der neuen Epoche der Reitkunst vielfach das Gegenteil der Fall. Es wurde diesem Hilfsmittel auch in der deutschen Reitvorschrift eine viel zu große Rolle eingeräumt. Die Spanische Reitschule beschränkte das Schenkelweichen von jeher auf seinen ursprünglichen Zweck, und Oberbereiter Niedermayer, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an diesem Institut wirkte, äußerte sich, dass Kopfherein und Kruppeheraus“ nur menschlicher Unverstand erdacht habe. Mit Unvernunft und ohne Maß angewandt sei diese Übung für jedes Pferd nur schädlich.“
Alois Podhajsky „Klassische Reitkunst“
Soweit so gut. Podhajsky schlägt dann auch in dieselbe Kerbe, wie es für mich ein großes Argument auch war:
„Warum soll man ein Tier das Seit- und Vorwärtsgehen mit genau der entgegengesetzten Stellung lehren, als man es dann von ihm im halben Travers verlangt? Man lehrt ja auch ein Kind von Haus aus das richtige Schreiben und bringt es ihm nicht über den Umweg einer falschen Schreibweise bei“.
Alois Podhajsky „Klassische Reitkunst“
Kann ich noch immer absolut unterschreiben und der wesentliche Punkt ist – wenn ich das Pferd extrem zur entgegen gesetzten Stellung bringe, dann bringe ich freilich auch die innere Körperhälfte, sprich den Brustkorb innen zum Heben und der Brustkorb außen sinkt ab. Also freilich genau das Gegenteil, was ich später in einem Travers oder Schulterherein möchte.
Ich habe also meine Pferde befragt – selbst im Schenkelweichen konnten sie bei einer wohl überlegten Dosierung die korrekte Brustkorbrotation beibehalten. Ich habe nun bei einigen Pferden, die die Rotation halten können, sprich den Brustkorb nicht in die entgegen gesetzte Richtung rotieren das Experiment Schenkelweichen dazu genommen.
Überprüfe den Inhalt
Was alle Pferde eint? Sie haben entweder eine längere Standbeinphase am Boden und damit einher eine längere Schwebephase – viel Hang zu Passage aber eine Schwierigkeit, die Beine schnell vom Boden zu nehmen.
Alle Pferde haben vom Schenkelweichen einen Profit mitgenommen, vorausgesetzt:
- Das Pferd ist am Sitz
- Das Pferd verändert unter keinen Umständen die Rotation
- Das Pferd wird nicht schwer auf der Hand
Schenkelweichen hat tatsächlich die Durchlässigkeit verbessert, es hat auch beispielsweise meinem hektischen Mandrake den Schenkel besser erklärt und ihm auch geholfen freier in den Schultern zu werden. Da wo etwa eine Traversale Schwierigkeiten bedeutete konnte durch wohl dosiertes Schenkelweichen die Hilfe für den Schenkel, der es zuvor schwieriger hatte, seitwärts zu treiben ein besseres Verständnis entwickelt werden – auch das seitwärts an sich konnte zur Gymnastizierung genutzt werden, es wurde dann bei korrekter Stellung und Biegung im Travers auch besser. Vor allem das seitwärts in Abduktion und Adduktion öffnete den Rumpfbereich und aktivierte die Rumpfträger.
Auch das Verständnis für Schenkelhilfen im Verhältnis von verwahrenden Hilfen kann durch Schenkelweichen erarbeitet werden.
Fazit: Ich würde Schenkelweichen nicht ganz an den Anfang der Ausbildung stellen. Wenn eine entsprechende Biegung gut verstanden wurde kann es wohl auch dazu beitragen die Qualität des inneren Schenkels zur Formgebung, aber auch für Seitwärts zu verbessern – gerade hektische Pferde profitieren davon, dass der Schenkel etwas „machen“ darf, aber nicht über Gebühr zum Einsatz kommt, bzw. kann sich auch durch das Seitwärts-Vorwärts das Missverständnis auflösen, dass es immer schneller gehen muss.
Die Frage ist also auch immer: Was kommt wann? Wann macht die Einführung welcher Inhalte Sinn und wann widerspricht man sich in der Ausbildung.
Weitere Inspirationen:
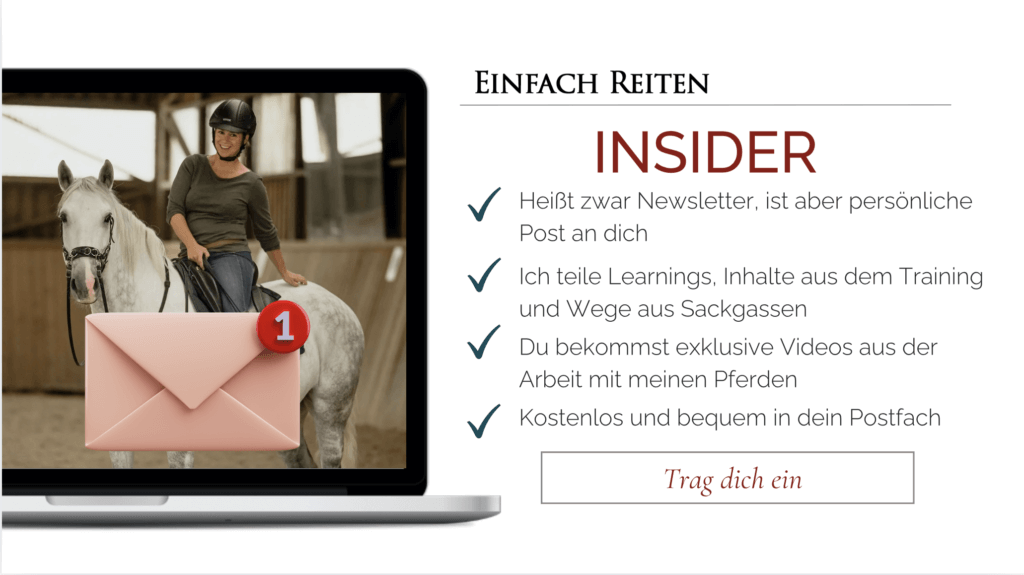




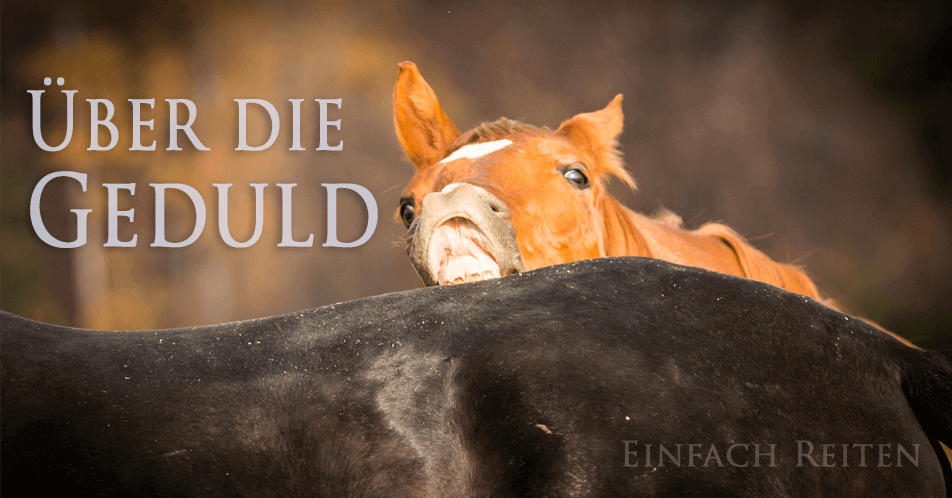


Letzte Kommentare