Vergangenes Wochenende war wieder mal „Bent Time“ angesagt. Im goldig-herbstlichen Ainring bei Salzburg drehte sich alles um Seitengänge. Wobei Drehung das absolut falsche Wort ist.
Für alle, die es verpasst haben, gibt es meine Zusammenfassung vom Kurs:
Seitwärts in der Theorie
„Eigentlich geht es gar nicht um seitwärts in den Seitengängen sondern um Balanceverschiebung und ob vier Beine eine korrekte Schwungrichtung wider spiegeln“.
Bent Branderup
Mit diesen Worten eröffnete Bent Branderup die erste Theorieeinheit. Und praktisch ging es auch gleich weiter. Wer Bewegung verstehen möchte, muss sich mit der Schwerkraft auseinander setzen. Wenn wir einen Seitengang versal (Schulterherein) oder traversal (Kruppeherein) arbeiten, dann sollen die Pferdebeine die korrekte Schwungrichtung der Schwerpunktverlagerung spiegeln. Problematisch ist allerdings, wenn man gegen die Gesetze der Schwerkraft und der Biomechanik verstößt und Knochen in eine falsche Winkelung bringt. Dann ist die Belastung nicht korrekt, Seitengänge können dann für das Pferd Schäden in Knochen, Gelenken usw. verursachen. Wird das junge Pferd dazu während des Wachstums falsch belastset, dann können sich früh Arnthrosen bilden.
„Der Tierarzt sagt, man soll das Pferd geradeaus auf hartem Boden reiten. Dies ist das veterinärmedizninische Attest an uns Reiter, eigentlich gar nicht reiten zu können“.
Bent Branderup
Das Problem sind also die Scherkräfte, die man aufs Gelenk bringt, wenn man Seitengänge falsch verstanden umsetzt. Der Motor, respektive die Kraft für die Bewegung wird immer aus der Hinterhand erzeugt. Wenn wir Pferde ausbilden, fangen wir laut Bent Branderup allerdings am falschen Ende an. Wir beschäftigen uns gerne mit Kopf, Hals und Schulter, dabei wird die Energie aus der Hinterhand erzeugt.
„Viele Ausbilder werden allerdings schon den Motor kaputt machen, bevor sie überhaupt mit der Arbeit beginnen. Wer die Hinterhand zur Dysfunktion bringt, kann nicht weiter arbeiten“.
Bent Branderup
Bent Branderup zeichnet nun in seinem für ihn typischen Stil in mehreren Farben Becken, Hüftgelenk, Knie, Sprunggelenk, Fesselkopf und Hinterhuf auf ein großes Flipchart. Nun geht es darum, die Hinterfüße zu ihrer Funktion unter die Körpermasse zu bringen. Wie immer gibt es auch viele Erläuterungen aus der Geschichte:
„Reite die Hinterbeine des Pferdes nach vorne und gib ihm dem Pferd eine Parade, so dass es die Gelenke der Hinterhand beugt.“
Xenophon
„So fragt König Louis XIII. seinen Lehrmeister Pluvinel: „Warum reiten wir all diese Seitengänge“. „Um gerade richten zu können“, antwortet Lehrmeister Pluvinel.“
Bent Branderup
Woher kommt der Vorgriff?
Wie fußt das Pferd nach vorne? Greifen die Hinterbeine tatsächlich unter die Masse? Auffällig ist das Hüftgelenk für die biomechanische Reise – denn das Hüftgelenk hebt den Fuß nach vorne. Wer ist also für den Vorgriff zuständig? Das Knie kann es nicht sein, denn es führt den Fuß nach hinten. Das Sprunggelenk dispensiert die Bewegung aus dem Kniegelenk. Der Mensch kann im Gegensatz zum Pferd Knie und Sprunggelenk separat bewegen, das Pferd kann dies nicht. Hier sind Knie- und Sprunggelenke durch die Spannsägenkonstruktion in einer engen Zusammenarbeit verbunden. Das Hüftgelenk alleine kann auch nicht dafür zuständig sein, wie das Pferd den Hinterfuß zu Boden setzt, das gesamte Becken Becken muss aktiv werden. Pferde, die allerdings nicht im Becken aktiv genug sind und die Hinterfüße durch Streckstellung von Knie- und Sprunggelenk absetzen, werden es mit Hankenbeugung und korrektem Vorgriff schwer haben.
Bent Branderup erklärt genau, wie die dreidimensionale Schwingung der Wirbelsäule aus einem aktiven Becken entsteht. Das Becken soll sich nach vorne-unten bewegen – und zwar deutlich. Dies wäre unter anderem ein Qualitätsmerkmal in der Blickschulung in Punkto Vorgriff.
„Diese vor- und runter Bewegung des Beckens führt zu einer Tätigkeit im Rücken, die wir Reiter dann als Schwung bezeichnen. Friedrich von Krane erwähnt diesen Begriff der dreidimensionalen Schwingung als erster in der LIteratur.“
Bent Branderup
Besonders betont Bent Branderup auch sein Auge hinsichtlich des Schulterblattes des Pferdes zu schulen. Was macht das Schulterblatt in der Arbeit in den Seitengängen. Die Tätigkeit der linken Hüfte sollte sich automatisch auf die rechte Schulter übertragen.
Nun wird es praktisch – Branderup demonstriert vor dem Publikum den eigenen Rückenschwung. Wir als Menschen sind Traber, schwingen also auch diagonal. Wenn wir uns in Seitengängen ausprobieren, dann überträgt sich der Rückenschwung auch auf unsere Arme. Bleibt die Schwungrichtung zu den „Hinterbeinen“ passend, dann schwingen auch die Arme in die entsprechende Richtung.
Wenn wir Seitengänge observieren, dann sollen alle vier Beine des Pferdes eine versale, traversale oder renversale Schwungrichtung zeichnen. Fehlerhaft ist also, wenn ein Beinpaar versal und eines renversal unterwegs ist.
Die unterschiedlichen Schwungrichtungen machen es für unser Auge möglich zwischen einem Schenkelgänger und einem Rückengänger zu unterscheiden. Balancerichtung muss sich also auch über den Rücken übertragen. Wird aber die Körpermasse förmlich auf den Brukstkorb geschoben, dann muss die Schultermuskulatur den Brustkorb schwer auffangen, die Schwungübertragung und ein lockeres Vorschwingen der Vorderbeine aus der Schulter heraus wird blockiert.
Da Pferde kein Schlüsselbein haben, übernimmt die so genannten thorakale Muskelschlinge einen Haufen Arbeit. Hier skizziert Bent Branderup die Auswirkung von Zucht und Selektion auf das Pferd.
„In dem Moment, wo der Brustkorb zu schwer in der Muskulatur hängt, wird die Schulter die Schwingung des Rückens blockieren und aus dem Rückengänger wird ein Schenkelgänger. Das passiert ziemlich leicht, wenn wir auf dem Pferd sitzen, daher haben wir um diesem Phänomen entgegen zu wirken größere und mächtigere Schultern beim Pferd gezüchtet. Quarter Horses haben beispielsweise riesige Schulterblätter. Viel Gewebe kann nun helfen den Brustkorb zu tragen. Weil das Pferd aber mehr Thoraxschlinge bekommt, hat es davon aber nicht bessere Ellenbogen- oder Karpalgelenke. Auch die Hufrolle wurde in dieser Zuchtselektion nicht besser. Im Gegenteil. Wir sehen in der Folge viele Hufrollenbefunde, Verschleißerscheinungen an den Ellenbogen oder Knickbeine. Wenn wir die Pferde auf der Vorhand reiten, dann haben die Tiere ganz sicher Verschleißerscheinungen an der Vorhand. Wir können also ein Schulterblatt größer züchten, aber die Stabilität der Gelenke darunter ist nicht automatisch mit verbessert.“
Bent Branderup
Weiter erklärt Bent Branderup, dass die menschlichen Karpalgelenke eine Drehbewegung schaffen, die Karpalgelenke des Pferdes können das allerdings nicht. Die natürliche Bewegung des Karpalgelenks ist Beugung – daher ist es so wichtig, dass wir in den Seitengängen nicht gegen die Karpalgelenke arbeiten.
Und noch ein Stichwort zu den schon angesprochenen Schulterblättern:
„Je kleiner und aufrechter das Schulterblatt ist, umso mehr kann es sich auf dem Rippenbogen bewegen. Je länger und waagrechter das Schulterblatt ist, umso weniger kann es von der Schwungrichtung abweichen. Daher werden falsche Seitengänge noch problematischer.“
Bent Branderup
Schwierig in der Vorstellung? Dann hat Bent Branderup gleich ein passendes Bild parat. Der Spanier im alten Typ mit viel Campaneo. Unter Campaneo (übersetzt bedeutet es übrigens Glockenspielergang) versteht man eine hohe Knieaktion des Vorderbeins mit einem seitlichen Ausschwingen der Vorderbeine. Campaneo wurde eigentlich als Gangfehler bezeichnet, im Stierkampf macht es diesem Pferd jedoch ein rasches Abweichen von der ursprünglichen Schwungrichtung möglich. Pferde mit einem flachem Brustkorb und flachem Schulterblatt können nur sehr wenig von dieser Schwungrichtugn abweichen. Das unterstreicht warum man Pferde vom alten Spanischen Schlag im Stierkampf oder Rinderarbeit gebrauchen konnte, den Trakehner eher weniger.
Die Reise der Biomechanik ist jedoch noch nicht zu Ende. Nun spricht Bent Branderup von der Halswirbelsäule, konkret von der Mobilität im sechsten und siebten Halswirbel. Urpferde, Zebras oder andere, nennen wir sie mal „ursprüngliche“ Equiden haben hier eine starke Bandverbindung nach unten für jeden Halswirbel, während die modernen Reitpferde diese Verbindung verloren haben.
Auch dies führt Bent Branderup als weiteren Grund auf, warum es sich lohnt so pingelig mit den Seitengängen zu arbeiten.
Woher kommt die Entschleunigung?
Weiter wird nun über Vorgriff und Rückschub diskutiert. Der Huf der Hinterhand des Pferdes muss korrekt auffußen und seine Kräfte ungehindert durch die Körpermasse fließen lassen. Dreht der Fesselkopf des Pferdes nach außen weg, dann ist die korrekte Krafterzeugung verloren gegangen. Auch wenn das Pferd auf der falschen Stelle auffußt ist keine korrekte Beeinflussung der Körpermasse gegeben.
Für den Reiter bedeutet das unbedingt den Unterschied zwischen vorwärts und rückwärts zu verstehen. Ist das vorgreifende Hinterbein gut gehoben und gut im Vorgriff, dann wird das Pferd den Rücken runden, wenn aber der stehende Hinterfuß quasi dominant ist, dann fällt der Rücken weg. Optisch können wir dies an der fehlerhaften Nickbewegung des Pferdes festmachen.
„Wenn der rückwärts schiebende Fuß dominant ist, dann sehen wir die Nickbewegung nach hinten oben – daher heißt es ja auch in der Literatur „an die Hand herantreten und über den Rücken gehen“. Akademisch gesehen wollen wir gerne, dass das Hinterbein exakt unter dem Schwerpunkt des Reiters auffusst. Wir wollen, dass Schwerpunkt von Reiter und Pferd zusammenpassen. Haben wir ein Pferd, das von Natur auf dort auffusst, dann wird es einfacher auszubilden sein. Bei manchen Pferden brauchen wir aber die Seitengänge, um es überhaupt zu einem Reitpferd zu machen“.
Bent Branderup
Der Hinterfuß muss gewisse Kräfte erzeugen – die erste und wichtigste Sache ist dabei die Teilnahme an der Entschleunigung. Man stelle sich vor auf einem trabenden Pferd zu sitzen. Der Trab hat eine Schwebephase und nun wollen wir aber entschleunigen – was wird wohl bequemer sein. Die Entschleunigung in der Hinterhand einzuleiten oder in der Vorhand zu bremsen?
Wenn das Pferd auf die Schulter fällt, ist es freilich nicht nur für den Reiter, sondern auch für sich selbst unbequem. Bent Branderup nimmt uns mit auf eine Reise zur Tragkraft, zur Schubkraft und zur Federkraft, die mit letzterer stark verwandt ist.
Für den Reiter ist es wichtig, ein Verständnis für den Schwerpunkt des Pferdes zu entwickeln – daher ist auch die Bodenarbeit so ideal, weil wir genau sehen können, was das Pferd mit den Informationen des Reiters tatsächlich macht.
„Alles, was man tut, muss man sehen – es gibt nichts, was nicht schief gehen kann. Das Problem der Gegenwart liegt darin, dass viele Menschen nach dem Prinzip leben: Fake it, till you make it. Das ist völlig falsch, denn dann wird man ja nur Meister des Täuschens. Unser Motto sollte daher lauten „Fail it till you nail it“. Das korrekte Ergebnis ergibt sich also nur durch die Perspektive auf den Fehler. Wenn wir keine Fehler machen dürfen, dann können wir falsch und richtig ja gar nicht beurteilen“.
Bent Branderup
Fehler und Problemlösungen wurden dann auch in den Praxiseinheiten aufgespürt. Seitengänge zum Geraderichten, Spüren von Schwungrichtungen und Formgebung der Oberlinie standen im Vordergrund.
Verliebe dich in den Fehler – dann reitest du Einfach.





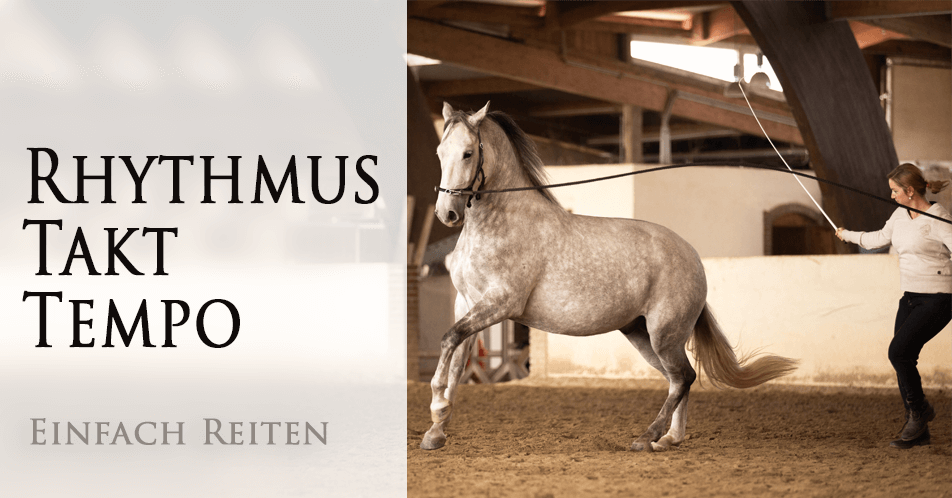
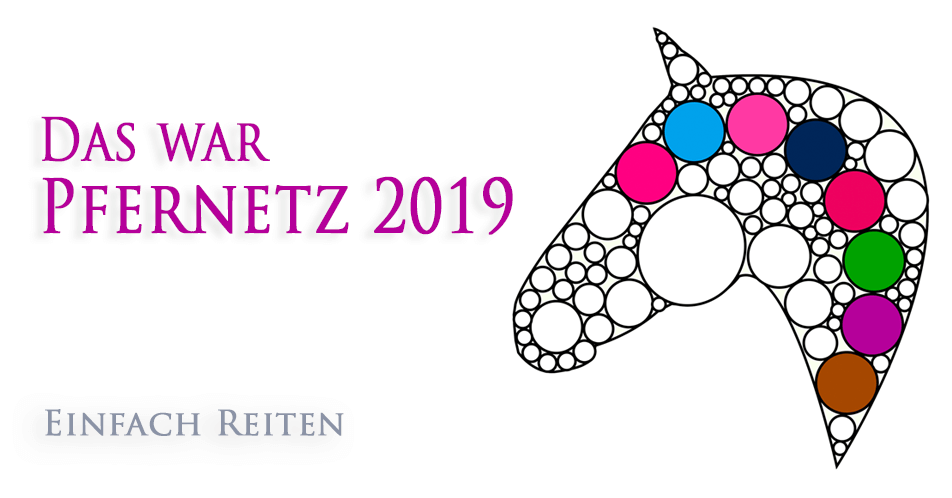

Letzte Kommentare